Veröffentlichungen
Kennen Sie schon diese Veröffentlichungen?
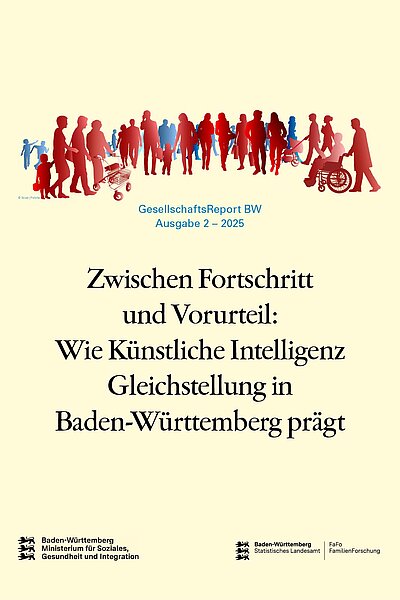
SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
Publikationsdatum: 26. November 2025
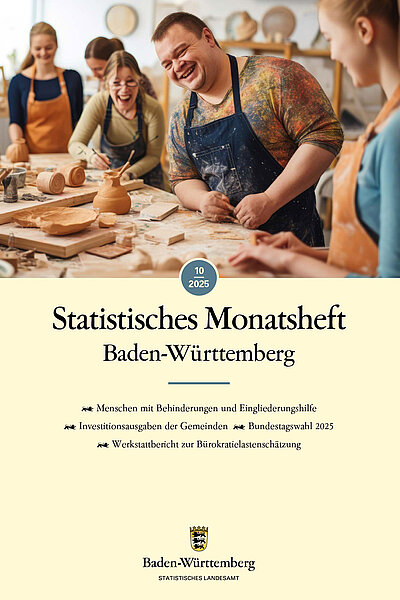
STATISTISCHES MONATSHEFT
Publikationsdatum: 05. November 2025
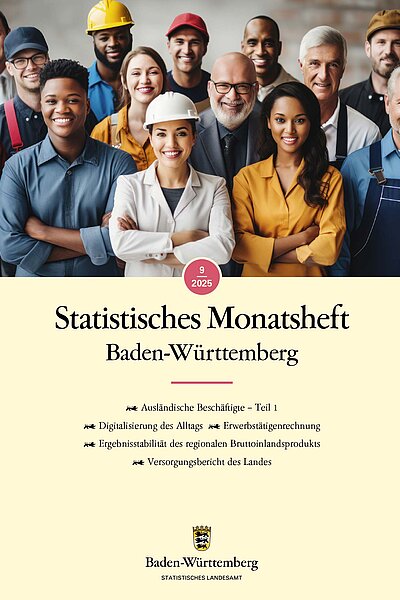
STATISTISCHES MONATSHEFT
Publikationsdatum: 20. Oktober 2025

SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
Publikationsdatum: 10. Oktober 2025



