Veröffentlichungen
Kennen Sie schon diese Veröffentlichungen?
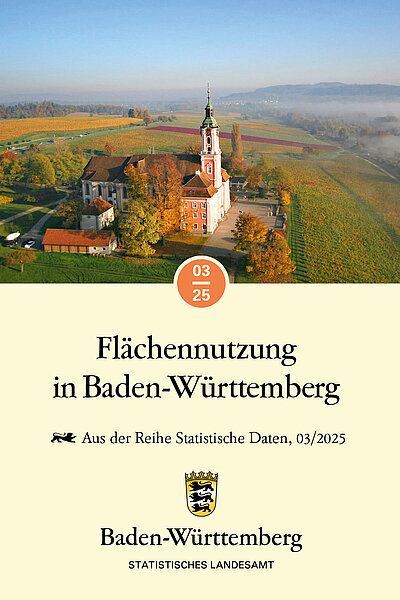
STATISTISCHE DATEN
Publikationsdatum: 22. Dezember 2025
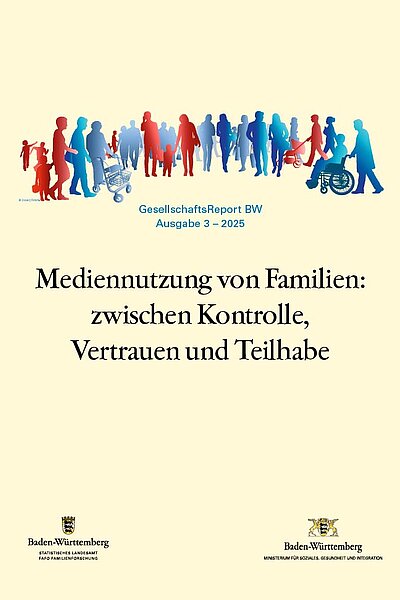
SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
Publikationsdatum: 22. Dezember 2025
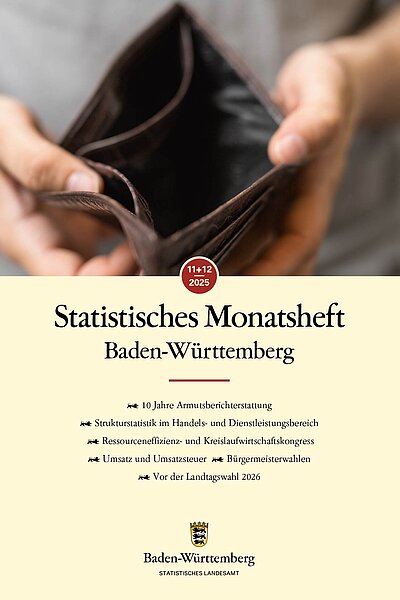
STATISTISCHES MONATSHEFT
Publikationsdatum: 18. Dezember 2025
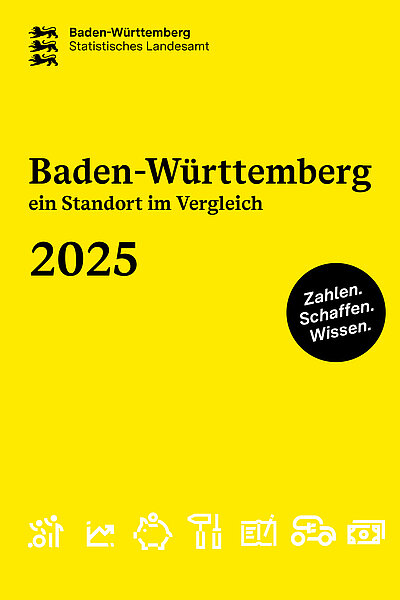
SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
Publikationsdatum: 15. Dezember 2025



